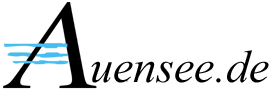|
„Ja Buaba, dös ka ma fei it so lossa“: Kindheitsgeschichten aus der Nachkriegszeit in Stadtbergen (1945-1955) 32. Hausmusik |
32. Hausmusik„Mit Recht erscheint uns das Klavier, wenn‘s schön poliert, als Zimmerzier. Ob‘s außerdem Genuss verschafft, bleibt hin und wieder zweifelhaft.“ So schrieb der berühmte Wilhelm Busch. Auch bei uns stand ab dem Jahre 1950 ein wunderbar aufbereitetes Klavier im Wohnzimmer, das unsere Mutter mit Hilfe einer Rentennachzahlung finanziert hatte. Ihr war ein Klavier sehr wichtig, da sie selbst recht gut spielte und unbedingt wollte, dass auch ihre Kinder das Klavierspiel erlernen. Aus finanziellen Gründen erhielt zunächst nur der älteste Bruder Klavierunterricht. Wir anderen drei klimperten vorläufig nur zum Spaß auf dem Instrument herum und versuchten, ihm mehr oder weniger erfolgreich wohlklingende Melodien und Harmonien zu entlocken. Unsere Mutter tolerierte diese Versuche und zog sich für ihre schulischen Arbeiten aus dem Wohnzimmer in die Küche zurück. Während drei Brüder im Laufe der Zeit mehr Gefallen an klassischer Musik fanden, fuhr Bruder Dietmar gänzlich auf Schlager und Jazz ab. Für die unfreiwilligen Zuhörer unserer Künste in den Wohnungen unter und über uns muss dieser ständige Stilwechsel sehr schmerzhaft gewesen sein. Eines Tages brachte ein Spediteur ein weiteres Klavier. Es war das Instrument meiner Mutter aus ihrer Berliner Heimat und wurde im “kleinen Kinderzimmer“ untergebracht. Eine neue Herausforderung für alle Hausbewohner! Während man im Wohnzimmer Mozart oder Bach übte, dröhnte gleichzeitig Dietmars Schlagerparade aus dem Kinderzimmer. Das Hörereignis war schon in unserer Wohnung kaum zu ertragen, wie muss es erst auf unsere Mitbewohner gewirkt haben! Belastend kam noch hinzu, dass das Berliner Klavier einen Riss im Stimmstock hatte und sich nicht sauber stimmen ließ. Es klang wie ein “schräger Otto“ aus den dreißiger Jahren. Dies schien aber Dietmars Spielfreude eher noch zu beflügeln. Trotzdem blieb Kritik an unserem Übungsdrang von Seiten des Hausherrn aus, weil Herr Schuster nicht gut hörte. Er arbeitete in der Schuhfabrik Wessels an einer Stanzmaschine. Der Lärm hatte sein Gehör dermaßen geschädigt, dass er keine hohen Frequenzen mehr wahrnehmen konnte. So war für ihn das doppelte Klavierspiel kein Problem. Empfindlich reagierte er nur, wenn seine Deckenlampe in Küche oder Wohnzimmer schwankte, weil wir Buben im Zimmer über ihm ein Kämpfchen austrugen oder im Kinderzimmer Tischtennis mit Rundlauf spielten. Dann klopfte er wütend mit dem Besenstiel gegen die Decke. Dies war für uns das Signal, unser Toben einzustellen. Schließlich wollten wir den Hausherrn nicht provozieren und zu uns herauflocken. Das passierte mitunter, wenn wir die Heftigkeit seiner Deckenstöße im Kampfgetümmel ignorierten.Als ich 1951 ins Gymnasium kam, schenkte mir eine Tante, sie war pensionierte Lehrerin, ihre Geige. Da der Geigenunterricht kostenlos angeboten. wurde, meldete mich die Mutter umgehend an. Daheim setzte ich mit meinem Gekratze einen neuen klanglichen Akzent in die Hausmusikszene. Aus zwei Zimmern hörte man Klavierspiel, aus dem dritten das jämmerliche Geschabe eines Anfängers.„Wenn du nicht sofort mit deinem Gezirpe aufhörst, dann zerschellen wir deine Geige an der Wand!“ schimpften meine Brüder.Unter diesen Drohungen hielt ich mich mit dem Üben zurück. Die Folge war, dass mich, wann immer ich mit meinem Geigenkasten auftauchte, jeder bat, diesen besser geschlossen zu halten. Da war bald klar, dass es für mich als Geiger keine Zukunft gab. Nur der Musiklehrer am Gymnasium glaubte an mich. Er suchte dringend Streicher für sein Schulorchester und feuerte mich immer wieder an durchzuhalten. Ab der 7. Klasse berief er mich ins Orchester. Beim ersten Schulkonzert im Pfarrsaal von St. Moritz saß ich am letzten Pult. Hinterher meinte meine Mutter, die den Auftritt “ihres Geigers“ unbedingt miterleben wollte: „Das Orchester hat ja ganz nett gespielt, aber wo warst denn du, dich habe ich gar nicht gesehen? Hat man dich am Ende nicht mitspielen lassen?“ „Doch, doch,“ sagte ich kleinlaut, „ich saß nur hinter dem Vorhang, den haben sie nicht ganz aufgezogen, weil ich die gemeinsamen Auf und Abstriche nicht einhalten konnte.“ So blieb meine “Geigenkunst“ vor der Öffentlichkeit verborgen. Besser ging es mir da schon beim Singen. In vielen Familien zeigen stolze Eltern, wenn Besuch kommt die Zeugnisse ihrer Sprösslinge vor oder schleppen andere Beweise der geistigen Leistungsfähigkeit ihrer Ableger herbei. Unsere Mutter konnte diesbezüglich nicht besonders mit uns punkten, wusste sich aber zu helfen. Dietmar und ich hatten sehr schöne Kinderstimmen. Kam Besuch, wurden wir angewiesen, pünktlich zu einer festgelegten Zeit sauber gewaschen im Wohnzimmer zu erscheinen. Die Mutter setzte sich ans Klavier und wir durften den erfreuten Gästen Lieder vorsingen, z.B.:„Abends will ich schlafen geh‘n…“ aus der Oper Hänsel und Gretel. Da bekamen die Besucher vor Rührung feuchte Augen. Voll Erstaunen hieß es: „Wunderbar, Frau Hierdeis, so glockenreine Stimmen, nein, ihre Buben, einfach herrlich und so nett wie die sind, die werden sicher mal große Sänger…“ Unsere Mutter meinte nur: „Wir werden schon sehen“, und an uns gewandt: „So, ihr verzieht euch jetzt wieder und geht spielen!“ Derartige Vorführungen konnten wir beide nicht leiden. Wer singt schon gerne am helllichten Nachmittag sauber gewaschen: „Abends will ich schlafen geh‘n?“ und noch dazu aus einem spannenden Fußballkampf herausgerissen!(Weitere Geschichten von Winfried Hierdeis in den nächsten Ausgaben des Stadtberger Boten)