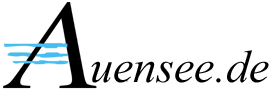|
„Ja Buaba, dös ka ma fei it so lossa!“ Kindheitsgeschichten aus der Nachkriegszeit in Stadtbergen (1945-1955) |
14. Erstkommunion 1949 Meine Mutter meinte, ich könnte schon in der 2. Klasse zur Erstkommunion gehen, also ein Jahr früher als meine Kameraden. Mir gefiel der Vorschlag, rückte der große Festtag auf diese Weise recht bald in greifbare Nähe.Unsere Mutter erteilte als Katechetin am Gymnasium Religionsunterricht und bereitete mich auf dieses Ereignis selbst vor. Eines Tages musste ich aber beim Herrn Dekan im Pfarrhof antreten. Er wollte sich persönlich von meinem Wissensstand zu den wichtigsten Fragen aus dem Kommunionunterricht überzeugen.Da saß ich nun allein im düsteren Wohnzimmer des alten Pfarrhofs, denn die kleinen Fenster ließen auch bei Sonnenschein nur wenig Licht in den Raum. Herr Dekan zündete sich eine dicke Zigarre an, sog genüsslich den Rauch in sich hinein und blies ihn in weißen Kringeln in meine Richtung. Ich bewunderte die Rauchkünste des hohen Herren und blickte gespannt zu ihm hinüber. Fräulein Babette, die Schwester und Haushälterin des Pfarrers legte einen großen roten Apfel in die Bratröhre des behaglich wärmenden Kachelofens. Dort brutzelte er wohlriechend seiner Verwandlung in einen wunderbaren Bratapfel entgegen, während ich examiniert wurde.Die Fragen waren allesamt sehr wohlwollend: Wie alt meine Brüder seien, ob es mir in der Schule gefalle, ob ich mich auf die Erstkommunion freue, ob ich meinen Beichtspiegel gelernt hätte und ob ich meine täglichen Gebete verrichten würde. „Ist der Apfel scho’ fertig?“ fragte Herr Dekan seine Schwester, „dann kann i’ mit der Fragerei aufhöra!“ Sie bejahte, brachte mir Besteck und ich machte mich über den herrlich duftenden Bratapfel her. Während mir der Pfarrer zum Abschied mit der Hand über den Kopf strich, meinte er: „Du kasch scho’ zur Erschtkommunion geha’!“ Freudig sprang ich nach Hause!Die Kleiderordnung für die Erstkommunion war vom Pfarrer festgelegt worden: Die Mädchen tragen ein weißes Kleid, weiße Handschuhe, einen Rosenkranz und das Gesangsbuch “Laudate“ in einer weißen Hülle, die Buben tragen einen schwarzen Anzug mit kurzer Hose und langen schwarzen Strümpfen, dazu das “Laudate“ in schwarzer Hülle.Änderungen oder Ausnahmen von der Kleiderordnung wurden nicht zugelassen. Begründung: „So geht mer seit 45 Johr in Schtadtberga zur Erschtkommunion und so lang i do bin, bleibt dös o!“ Für uns bedeutete diese Kleiderordnung, dass man zum Befestigen der Strümpfe entweder die verhassten Leibchen mit den Strapsen reaktivieren musste oder mit einem Gummiband die Strümpfe am Abrollen hinderte. Dies war uns lieber. In unserem Mehrfamilienhaus waren vier Wohnparteien und jede stellte einen Erstkommunikanten. Wir wurden alle bis zur Unkenntlichkeit herausgeputzt, jede Familie stellte den schönsten Kommunikanten des Hauses. Damals galt die Regel noch, dass man vor dem Empfang der Kommunion nüchtern bleiben musste, es gab kein Frühstück, ja nicht einmal einen Schluck Wasser. Selbst beim Zähneputzen musste man streng darauf achten, dass man sich beim Gurgeln nicht verschluckte, um das Fest nicht zu gefährden.Der 29. April 1949 war ein wunderschöner, sehr heißer Sonntag. Wir waren schon die letzten 14 Tage barfuß gelaufen, weil es so warm war. In den Gärten standen die Obstbäume in voller Blüte. Als die Glocken um 8.30 Uhr läuteten, verließ ich mit meiner Mutter und Tante das Haus in Richtung Schule. Hier versammelten sich alle Kommunikanten in einem Schulsaal im Erdgeschoss. Mein Freund Alois war auch schon da. Er entdeckte mich gleich, hielt seine Kerze wie einen Degen vor sich hin und rief: „Komm, Muck, wir machen einen Fechtkampf!“Eine geistesgegenwärtige Aufsichtsperson verhinderte das und stellte uns in der Reihe zum Abmarsch auf. Vor der Kirche mussten wir noch warten, bis endlich das feierliche Orgelspiel zum Einzug in die Kirche einlud. Unter der gleißenden Sonne und in unseren heißen Händen wurden die Stearinkerzen immer weicher und begannen sich bedrohlich zu neigen. Die Helfer, welche uns die Kerzen in der Kirche abnahmen hatten alle Mühe, sie senkrecht in die vorgesehenen Halterungen hineinzustellen. Der Gottesdienst war sehr festlich. Glücklich verließen wir die Kirche und zogen im Kreise der Familie nach Hause. Tante Rosa hatte eine Karottentorte gebacken. Die schmeckte wunderbar. Geschenke gab es auch, vor allem aber ein paar Geldgeschenke. Damit kaufte ich mir schon am nächsten Tag einen Lederfußball und ein blaues Fußballertrikot. Jetzt war ich der einzige Fußballer auf dem ganzen Oberen Stadtweg, der auch einen Ball besaß! Diese Tatsache machte mich plötzlich bei allen Buben der Umgebung sehr beliebt und ich genoss meine neue Bedeutung sehr. (Weitere Geschichten von Winfried Hierdeis in den nächsten Ausgaben des Stadtberger Boten)